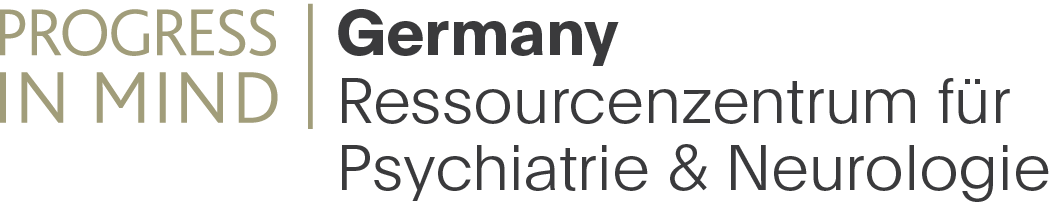Maßgeschneidert – Entdeckung und Entwicklung neuer Antidepressiva
Depressionen und Angststörungen sind die beiden psychiatrischen Erkrankungen, in die erhebliche Forschungsanstrengungen investiert wurden, ohne aktuell neue Therapien hervorbringen. Prof. Florian Holsboer, Mitgeschäftsführer von HMNC Brain Health, München, Deutschland, erläuterte seine Ansichten zu den Gründen dafür und wie künftig neue Wirkstoffe entdeckt werden könnten.
Antidepressiva wirken
Überraschenderweise liegen keine Daten vor, die belegen, dass es in den vergangenen 10 Jahren die Inzidenz von Depression gestiegen ist. Es scheint eher so zu sein, dass dies auf den Beginn des Kampfes gegen die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zurückgeführt werden kann – wobei der Anstieg von Verschreibungen von Antidepressiva mit einem Rückgang bei Suiziden einhergeht. Dies deutet darauf hin, dass Antidepressiva einer großen Zahl von Patienten großen Nutzen bringen und dass diese Medikamente entgegen manchmal geäußerter landläufiger Meinung doch wirksam sind. Wenn sie dem richtigen Patienten in korrekter Dosierung und Zeitdauer verabreicht werden, wird laut Prof. Holsboer bei 60-70% der Patienten tatsächlich eine Remission erreicht. Es bleibt jedoch viel zu tun, um die aktuell verfügbaren Therapien und das Management von Angststörungen und Depression zu verbessern.
Bei der Diagnose von Depression sind Neurowissenschaften entscheidend für den Erfolg
Depressionen werden durch vielfältige Mechanismen ausgelöst, was die Behandlung allein auf Grundlage der Diagnose schwierig macht. Die meisten Antidepressiva wirken über eine Verstärkung der serotonergen, noradrenergen und/oder dopaminergen Neurotransmission. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Antidepressiva leiten sich von unterschiedlichen Rezeptorprofilen und anderen pharmakologischen Wirkungen ab. Interessante Forschungsbereiche für neue antidepressiv wirksame Therapien zu finden, umfassen beispielsweise die Regulierung der Stressreaktionen auf akute und andauernde Belastungen, insbesondere über die Hypothalamus–Hypophysen–Achse, so Prof. Holsboer. Der Psychiater wies jedoch darauf hin, dass die Erforschung neuer Wirkstoffe an „den richtigen Patienten“ erfolgen muss – das bedeutet, an Patienten, bei denen der Wirkmechanismus des Medikaments zur Pathologie der Erkrankung passt. Dafür braucht man Marker für die zugrundeliegende Erkrankung. Solange nicht versucht wird, die Diagnose auf der Basis dieser neurowissenschaftlichen Erkenntnisse zu stellen, wird es nach Ansicht von Prof. Holsboer nicht möglich sein, Richtlinien zur zielgerichteten Behandlung der Patienten mit den richtigen Medikamenten zu entwickeln.
Stresshormone markieren den Fortschritt
Derzeit gelten zwei Stresshormon-Therapien als vielversprechende Option – Antagonisten der Rezeptoren des Corticotropin-releasing hormone 1 (CRHR1) und Vasopressin1B (V1BR). Prof. Holsboer ging auf die Einzelheiten ein und erklärte, dass nur ein begrenzter Anteil an Patienten mit stressbedingter Depression einen dauerhaft erhöhten CRH- oder Vasopressin-Spiegel aufweist. Derzeit werden Tests oder Marker für eine CRHR1- und V1BR-Überexpression entwickelt. Inzwischen wurde beispielsweise eine gesteigerte Rapid Eye Movement (REM)-Aktivität im Schlaf als Marker für eine CRHR1-Überexpression identifiziert. Diese Patienten könnten von einem CRHR1-Antagonisten am meisten profitieren. In ähnlicher Weise können Patienten mit zentraler Vasopressin-Überaktivität nach Anwendung eines Dexamethason-CRH-Tests identifiziert werden, wobei diese Patienten mit größerer Wahrscheinlichkeit positiv auf V1BR-Antagonisten ansprechen.
Kassenschlager-Strategie gescheitert
Inzwischen sind jedoch die Studienprogramme mit CRHR1-Antagonisten von zahlreichen Pharmaunternehmen fehlgeschlagen. Ein Großteil dieser Unternehmen hat die Erforschung und klinische Entwicklung von Anxiolytika und Antidepressiva eingestellt. Prof. Holsboer stellte fest, dass zwar der Forschungsansatz, ein Medikament zu entwickeln, das bei den meisten Patienten wirksam ist und dementsprechend auch kommerziell ein großer Erfolg ist, gescheitert ist. Das bedeutet aber nicht, dass diese Wirkstoffe nicht wirksam sind. Ein stärker personalisierter Therapieansatz könnte in dieser Situation die Lösung für die Entdeckung neuer Medikamente in der Psychiatrie sein.
Entgegen landläufiger Meinung bürdet die Personalisierung der Medizin der Gesundheitsversorgung keine riesigen zusätzlichen Kosten auf, so der Psychiater. Es sei ein weitverbreiteter Mythos, personalisierte Medizin sei teuer, bringe dem Patienten wenig Mehrwert und den Pharmaunternehmen eine geringere Rendite. Dieser Vorwurf treffe vielmehr eher auf die klinische Medikamentenentwicklung auf der Basis statistik-gestützter Methoden zu, wie sie in der Vergangenheit praktiziert wurde. Die personalisierte Medizin ermöglicht hier eine radikale Abkehr, für die diese Kritik nicht gilt, resümierte Prof. Holsboer.
Die Blut-Hirn-Schranke entscheidet
In Tiermodellen ist es bereits möglich, die Antidepressiva-Moleküle an den Genotyp der in den Blutgefäßen des Gehirns vorhandenen Transproteine P-Glykoproteine anzupassen, die damit eine Wächterfunktion ausüben, ob ein Molekül die Blut-Hirn-Schranke (BHS) überwinden kann. Damit können Medikamenten-Kandidaten künftig daraufhin getestet werden, ob sie die BHS passieren können oder nicht. Lässt der Genotyp des Wächterproteins P-Glycoprotein darauf schließen, dass das Antidepressivum nicht ins Gehirn gelangen kann, sollte ein anderer Wirkstoff verabreicht werden, der dies kann. So bestimmen letztlich die P-Glycoprotein-Genotypen der Patienten die Wahl des passenden Antidepressivums.
Mehr fürs Geld!
Prof. Holsboer gab hier zu bedenken, dass die Steuerzahler angesichts des erhöhten Forschungsaufwandes und der steigenden Zahl von Wissenschaftlern eine Rendite für ihre steuerlichen Investitionen erwarten, d.h. dass wirksame Therapien schneller entwickelt werden. Ein stärker personalisierter Ansatz in der Psychiatrieforschung wäre eine hierauf eine passende Antwort, weil man dadurch unwirksame Wirkstoffe früher identifizieren könnte. Die Pharmaforschung wäre dadurch effizienter und möglicherweise auch kostengünstiger.
Leiden Tiere an Depressionen?
Eine interessante Frage, die bei Prof. Holsboer Skepsis auslöste. Wenn Tiere nicht in gleicher Weise wie Menschen an Depression leiden, warum sollte man sie dann in präklinischen Studien zur Testung von Antidepressiva einsetzen? Ohne eine Lockerung der Toxizitäts- und anderer wichtiger Sicherheitsprüfungen befürworten zu wollen, könnte eine frühere Einführung von Therapien in die klinische Erprobung die Entwicklungsprogramme ebenfalls beschleunigen, so der Psychiater.
Biosignatur der Zukunft
Für Prof. Holsboer sind die erfolgversprechendsten Forschungsfelder für innovative Therapien von Angststörungen und der Major Depression vor allem die Humangenetik, insbesondere die Genom-Forschung, sowie die Entdeckung von Biomarkern als Surrogate für das zugrundeliegende Krankheitsbild und die chemische Biologie. Er prophezeite abschließend, dass im Jahr 2030 eine medikamentöse Behandlung und Krankheitsprävention durch eine individuelle Anpassung von Therapien an die Biosignatur des Patienten möglich sein werden.
Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.