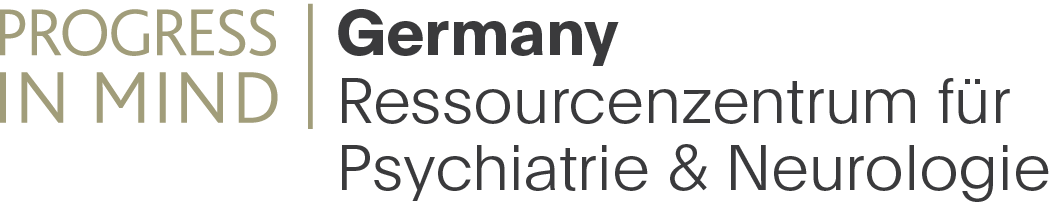Genügt bei Patienten mit einer Depression für die Definition einer Remission die Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)-Skala? Das war die Frage, die auf einem von Lundbeck geförderten Satellitensymposium auf dem CINP 2018 gestellt wurde. Die Antworten spiegeln die Komplexität der Erkrankung wider und legen wichtige Unterschiede zwischen den von behandelnden Ärzten beurteilten und den von Patienten als den wichtigsten eingeschätzten Outcome-Parametern offen. Dazu gehört auch die Kognition.
Die vielen Gesichter der Depression
Die Depression ist eine komplexe Erkrankung. Aktuell verlangt die Diagnose das Vorhandensein von fünf der neun im DSM-5-Manual aufgelisteten Merkmale. Dies bedeutet, dass bei zwei Personen die Diagnose einer Depression gestellt werden kann, und die Personen nur ein einziges gemeinsames Krankheitsmerkmal aufweisen.
So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass eine aktuelle Feldstudie in den USA und Kanada die Verlässlichkeit der Definition des DSM-5-Manuals – beurteilt als Maß, in dem zwei Ärzte unabhängig voneinander zu dem Ergebnis kommen, dass bei einem bestimmten Patienten die Diagnose einer Depression gestellt werden kann – in Frage gestellt wird.
Es ist unklar, ob die täglich in der klinischen Praxis verwendeten Beurteilungsskalen wie etwa die Hamilton Rating Scale for Depression (HAMD) oder die MADRS die Vielfalt depressiver Symptome ausreichend widerspiegeln. Unklar ist auch, ob sie die Symptome der Krankheit bewerten, die den Patienten die meisten Probleme machen, so Prof. Koen Demyttenaere, Universität Leuven, Belgien, auf dem CINP. Die MADRS ist hochsensibel für Veränderungen der Psychopathologie – aus dem Grund, weil die Items entsprechend ausgewählt wurden. Das ist für den Untersucher eine hilfreiche psychometrische Eigenschaft. Allerdings erfasst die Skala möglicherweise nicht jene Krankheitserfahrungen, die für die an einer Depression leidenden Patienten am wichtigsten sind.
Es ist unklar, ob die klinischen Beurteilungsskalen diejenigen Symptome/Aspekte der Depression abdecken, die den betroffenen Patienten die meisten Probleme machen
Tatsächlich zeigt eine aktuelle Studie einer belgischen Arbeitsgruppe um Prof. Demyttenaere eine erhebliche Diskrepanz zwischen dem, was die Ärzte und ihre Patienten unter einer erfolgreichen Behandlung der Depression verstehen. In die Studie wurden 426 ambulant behandelte Patienten mit einer Major Depression (Major Depressive Disorder; MDD) eingeschlossen.
Patienten konzentrieren sich auf positiven Affekt
Ärzte stuften die Verringerung negativer affektiver Symptome wie etwa Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit als am wichtigsten ein. Im Gegensatz dazu wünschten sich die Patienten am meisten ein sinnvolles Leben führen und dieses genießen zu können, mit ihrer Situation zufrieden zu sein und sich konzentrieren zu können. Diese Konzentration auf positiv besetzte affektive Outcome-Parameter war beim Follow-Up nach drei Monaten noch größer als zu Beginn der antidepressiven Pharmakotherapie und sie war bei Patienten mit wiederkehrender Depression größer als ersterkrankten Patienten.
Die MDD ist charakterisiert durch eine Reihe sich überlappender Merkmale, darunter somatische und affektive Symptome, der Funktionsstatus und häufig auch Angstsymptome. In der genannten belgischen Studie bestand Übereinstimmung zwischen Ärzte und Patienten darin, indem beide Gruppen somatische Symptome als vergleichsweise unwichtig einstuften.
Dr. Rudolf Uher und Kollegen vom London Institute of Psychiatry, London, Großbritannien, werteten Daten aus den STAR*D- und GENDEP-Studien zusammen mit den Daten der Untersucher-basierten MADRS- und HAM-D17-Skalen sowie dem von den Patienten ausgefüllten Beck-Depressions-Inventar aus. Die Faktorenanalyse identifizierte drei Dimensionen – beobachteter Affekt, Kognition und neurovegetative Symptome (einschließlich Schlaf und Appetit) - sowie sechs Faktoren.
Affekt und Kognition
Ein Symptom-Cluster konzentrierte sich darauf, was die Autoren als „Interessen und Aktivitäten“ bezeichneten. Dieser Faktor beinhaltete Interessen, Freude, Konzentration, Entschlossenheit, die Fähigkeit zum Fühlen, Aktivität und Energie sowie Sexualität.
Kognition und positive Stimmung sind eng miteinander verbunden
Dieser Cluster wird im Wesentlichen durch die Symptome Kognition und positiver Affekt charakterisiert, stellte Prof. Demyttenaere fest. Die Tatsache, dass er ein Prädiktor für einen schlechten Outcome unabhängig vom Schweregrad der Depression zu Behandlungsbeginn ist, legt nahe, dass sich die antidepressive Therapie darauf fokussieren sollte. Dr. Uher und Kollegen folgerten daraus, dass sich die Bedeutung dieser Symptome in den Behandlungsstrategien und bei der Bewertung des Ansprechens widerspiegeln sollte.
Diese Forderung wird kontrastiert durch den Befund, dass nur eine einzige von den 17 Fragen im HAM-D17 das Arbeitsleben und die Interessen des Patienten betrifft. Beim MADRS betrifft ebenfalls nur eine (von zehn Fragen) die Kognition (Konzentrationsschwierigkeiten).
Eine veränderte emotionale Verarbeitung geht dem klinischen Ansprechen voraus
Die Stärkung der Fähigkeit der Patienten, die Welt in positiver Weise zu erleben, scheint ein integraler Bestandteil einer erfolgreichen antidepressiven Therapie zu sein. Eine objektive Beurteilung der emotionsbezogenen Kognition kann zum Verständnis dessen beitragen, wie Antidepressiva wirken und ist ein Maß für frühe Veränderungen, welche die Patienten nicht unbedingt selbst bemerken. Dies zeigen Studiendaten, die Prof. Catherine Harmer, University of Oxford, Großbritannien, präsentierte.
Alltägliche kognitive Vorgänge werden von Emotionen beeinflusst
In einer Studie mit depressiven Patienten und einer gesunden Kontrollgruppe führte die kurzzeitige Gabe eines Antidepressivums dazu, dass die Patienten bei der Fähigkeit, glückliche Gesichter zu erkennen, fast mit der Kontrollgruppe gleichzogen. Diese Wirkung ließ sich bei einem Placebo nicht erzielen. In einer weiteren Studie führte die Behandlung mit Antidepressiva zu einer vergleichbaren Normalisierung der Gedächtnisleistung bei Wörtern mit positiver emotionaler Konnotation.
Bei denjenigen Patienten, bei denen sich die Erkennung glücklicher Gesichtsausdrücke zwei Wochen nach Beginn der Einnahme von Antidepressiva verbessert hatte, nahm auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass die klinische Symptomatik nach sechs Wochen auf die Behandlung ansprach – im Gegensatz zu Patienten, deren Erkennung von Gesichtsausdrücken sich wenig verbessert hatte. Diese Beobachtung wurde inzwischen in einer unabhängigen Studie repliziert. Es scheint also, dass eine antidepressive Pharmakotherapie den Boden bereiten kann, dass Patienten beginnen, die Welt positiver zu betrachten. Diese frühe, objektiv messbare Veränderung ist der Vorbote einer therapeutischen Response – auch wenn die Patienten subjektiv erst später eine langsame Besserung spüren und dann auch die Beurteilungsskalen erste messbare Verbesserungen der Symptomatik anzeigen.
Korrelate zur Hirnfunktion
Das kortikolimbische System, besonders die Amygdala, spielt eine wichtige Rolle bei der emotionalen Bewertung von Situationen. Studien konnten mithilfe des funktionellen MRT (fMRT) eine Beziehung zwischen der Anfälligkeit für eine Depression und einer hohen Empfindlichkeit für negative Stimuli in der Amygdala zeigen. Dies lässt darauf schließen, dass ein depressionsanfälliges Gehirn gegenüber negativen Erfahrungen und Stimuli sensitiver ist als gegenüber positiven Reizen.
Verändert die antidepressive Therapie den Bias zugunsten negativer Stimuli bei der emotionalen Verarbeitung, so schafft sie die Voraussetzung, dass die Patienten die Welt wieder positiver wahrzunehmen beginnen
Befunde im fMRT weisen darauf hin, dass die erkennbare Tendenz zugunsten negativer Gesichtsausdrücke bereits nach einer Woche einer antidepressiven Pharmakotherapie verringert werden kann – auch wenn die depressive Symptomatik zu diesem Zeitpunkt sich noch nicht gebessert hat.
Eine derartige Pharmakotherapie-assoziierte Korrektur dieses negativen Bias kann ein hilfreicher Schritt hin zum Ansprechen auf die Behandlung sein. Aber sie ist nicht der einzige Faktor. Die Veränderung der emotionalen Verarbeitung durch ein Antidepressivum scheint noch wirksamer zu sein, wenn sie durch ein positives soziales Umfeld des Patienten, beispielsweise einer guten interpersonellen Unterstützung unterstützt wird, legte Prof. Harmer nahe.
Wege zur Verbesserung
Die kognitive Dysfunktion ist als Kernsymptom der MDD anerkannt, seit die Erkrankung zum ersten Mal beschrieben wurde. Dennoch wurde ihr weder bei der Therapieplanung noch bei der Bewertung des Ansprechens die entsprechende Priorität eingeräumt.
Prof. Judith Jaeger, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA, hat eine Reihe von Gründen aufgelistet, warum Kognition jetzt die Aufmerksamkeit erhalten sollte, die sie verdient:
- Etwa die Hälfte aller Patienten mit MDD geben an, sie würden durch kognitive Beeinträchtigungen verunsichert.
- Zwischen 30% und 50% der Patienten mit MDD leiden unter objektiv feststellbaren kognitiven Beeinträchtigungen. Das gesamte Ausmaß der Beeinträchtigungen beträgt etwa 0,5 einer Standardabweichung – das entspricht ungefähr einem Blutalkoholgehalt von 0,05% bzw. 0,5‰. Dies ist eine relevante Größenordnung, auch hinsichtlich ihrer klinischen Folgewirkungen.
- Subjektiv wahrgenommene Beeinträchtigungen sind nicht immer objektiv nachweisbar. Umgekehrt entsprechen objektiv gemessene kognitive Beeinträchtigungen nicht immer dem subjektiven Erleben des Patienten. Daher ist es wichtig, die kognitive Funktion zu messen.
- Eine funktionelle Recovery nach einer Depression folgt nach einer Verbesserung der kognitiven Funktion. Diese Beziehung zwischen Funktionsstatus und Kognition ist unabhängig davon, ob affektive Symptome fortbestehen oder nicht.
- Dies deutet darauf hin, dass die Entwicklung und Besserung kognitiver Beeinträchtigungen nicht per se mit der Entwicklung und Besserung der affektiven Stimmungslage assoziiert ist.
- Bleibende funktionale Beeinträchtigungen sind eng mit bleibenden kognitiven Beeinträchtigungen assoziiert.
- Obwohl hierzu keine Langzeitdaten vorliegen, lässt die Arbeit von Prof. Philip Gorwood, Sainte-Anne Hospital, Paris, Frankreich, und anderen Autoren den Schluss zu, dass die kognitive Funktion mit zunehmender Anzahl depressiver Episoden abnimmt.
Daher ist es wichtig, die kognitive Funktion zu evaluieren, auch im Hinblick darauf, ob sie sich mit Beginn einer depressiven Episode verschlechtert hat: Viele Patienten erleben eine Abnahme der kognitiven Fähigkeiten, auch wenn sie noch im Normbereich bleiben.
Zur Beurteilung der Kognition des Patienten und der Wirkung der Behandlung ist heute nicht mehr eine komplette neuropsychologische Testbatterie notwendig. Inzwischen stehen computergestützte Tools zur Verfügung, die schnell und verlässlich Änderungen der kognitiven Funktion messen. Dadurch wird die routinemäßige Anwendung in der Klinik erleichtert, berichtete Prof. Jaeger.
Den Vorsitz bei dem Symposium hatte Prof. Bernhard Baune, University of Adelaide, Australien. Er lenkte zu Beginn des Symposiums die Aufmerksamkeit auf die Anzahl der Zitationsverweise auf die FOCUS-Studie – ein Zeichen des wachsenden Interesses an der kognitiven Dimension der Depression.
Les points saillants du colloque présentés par notre correspondant se veulent une représentation fidèle du contenu scientifique présenté. Les points de vue et opinions exprimés sur cette page ne reflètent pas nécessairement ceux de Lundbeck.