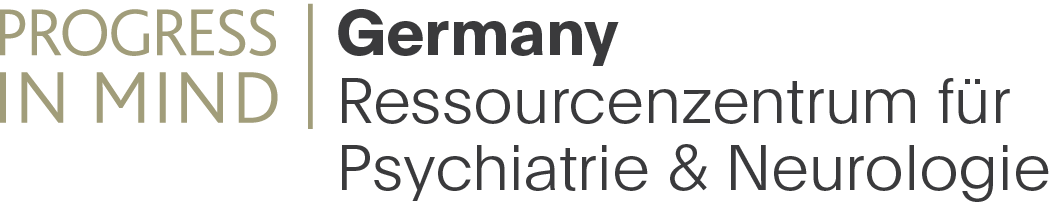Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie Ihre Umwelt als etwas „Fremdartiges“ erlebt, Sie aufgrund einer empfundenen Andersartigkeit ablehnt oder Ihnen mit Vorurteilen begegnet? Psychisch schwerkranke Menschen erleben eine solche Ablehnung besonders häufig, mitunter täglich. Sie sind aufgrund ihrer Erkrankung und den damit einhergehenden Symptomen geradezu als „anders“ gebrandmarkt, kurzum: sie werden stigmatisiert. Dabei leiden die Betroffen gleich doppelt: Unter ihrer Erkrankung – und der Reaktion des Umfeldes darauf. Scham, Selbstvorwürfe, bis hin zu einer geringeren Inanspruchnahme von Behandlungsoptionen: Die emotionalen, aber auch gesundheitlichen Folgen externer sowie internalisierter Stigmatisierung können weitreichend sein und wiegen mitunter schwerer als die Erkrankung selbst.1 Auf eine Entstigmatisierung sollte daher gesamtgesellschaftlich hingewirkt werden – ÄrztInnen können hier einen wichtigen Beitrag leisten.
Ein Vermieter, der lieber keinen Psychosekranken in seine Wohnung einziehen lässt – und so Wohnungslosigkeit Vorschub leistet. Eine Arbeitgeberin, die ihrem depressiven Angestellten wenig zutraut und nach vorgeschobenen Gründen für eine Kündigung sucht. Eine Bekanntschaft, die sich nach Offenlegung psychischer Probleme von einer Betroffenen abwendet und ein Gefühl von Ausgestoßenheit nährt. Kurzum: Wiederkehrend können psychisch kranken Menschen Ablehnung oder sogar Anfeindungen entgegengebracht werden – für einen Aspekt ihres Seins, an dem sie keine Schuld tragen und auf dessen Existenz sie in manchen oder gar weiten Teilen keinen Einfluss haben. Dabei tragen nicht die Erkrankten, sondern trägt die stigmatisierende Gesellschaft den eigentlichen, viel größeren Makel.
Kranke zweiter Klasse? Das Stigma schwerer psychischer Erkrankungen
Auch im medizinischen Kontext kann Stigmatisierung Probleme schaffen oder verstärken. So kann sie sich, oft flankiert durch Schuldgefühle und ein vermeintliches gesellschaftliches Tabu, negativ auf die Inanspruchnahme von Hilfe und Therapien auswirken. Andere Betroffene schämen sich möglicherweise, wenn sie für andere sichtbar auf Medikamente angewiesen sind – worunter die Adhärenz leiden kann. Letztlich kann Stigmatisierung so mitunter auch zur Aufrechterhaltung des Zustandes, der sie ausgelöst hat, beitragen.
Affektive Störungen wie Depressionen konnten in den vergangenen Jahren vom gesellschaftlichen Diskurs rund um das Thema „Burnout“ und die Implikationen für uns als Leistungsgesellschaft in puncto Stigmatisierung profitieren. So nimmt die wahrgenommene „Andersartigkeit“ von Menschen mit Depressionen ab – immer mehr Menschen können entsprechende Symptome (oft in milderer Form) womöglich wiedererkennen und auf sich beziehen.3 Doch leider färbt dies nicht auf andere Krankheiten ab. Im Gegenteil: Vorurteile gegenüber an Schizophrenie erkrankten Menschen und die Stigmatisierung, die sie erfahren, scheint sich zu festigen oder gar zu zunehmen. Menschen mit solch schweren Erkrankungen werden häufiger als Bedrohung erlebt und/oder abgelehnt [Abb. 1].3 Damit trifft die Doppelbelastung aus Erkrankung und Stigma eine besonders vulnerable Personengruppe.
Abb.1: Ablehnung von Menschen mit psychischen Krankheiten in Deutschland (bezogen auf eine Fallgeschichte)2
Von „Recovery“ und Entstigmatisierungs-Profis
PsychiaterInnen, Pflegekräften und anderen Fachkräften kommt eine wichtige Funktion zu, wenn es gilt eine Entstigmatisierung im Sinne der Betroffenen voranzutreiben. Doch auch sie sind nicht immer vor Vorurteilen oder Voreingenommenheit gefeit – und können so in manchen Fällen unfreiwillig selbst einen Beitrag zur Stigmatisierung Kranker beitragen. Dies betrifft insbesondere schwere Erkrankungen wie Schizophrenie.4Eine solche skeptische Einstellung gegenüber psychisch kranken Menschen kann dadurch bedingt sein, dass die Fachkräfte die PatientInnen oft nur in Krisenzeiten erleben und die Zeiten zwischen den Krankheitsphasen sich ihrer Wahrnehmung entziehen.3 Recovery-orientierte Ansätze, also eine ressourcenorientierte Förderung und Unterstützung des Genesungspotenzials, könnten zu einer veränderten, positiveren Wahrnehmung der Betroffenen beitragen. Ein Beispiel wäre der Einsatz von Psychiatrie-Erfahrenen als GenesungsbegleiterInnen („EX-IN“), also die Zusammenarbeit mit „Profis aus Erfahrung“ als Bereicherung für das Behandlungsteam. Ein klares Eintreten von Fachkräften für die Entstigmatisierung psychisch erkrankter Menschen – im individuellen Kontakt, wie auch im gesellschaftlichen Kontext – sollte weiter ausgebaut und gestärkt werden. Das Hinterfragen eigener Vorurteile kann ein erster wichtiger Schritt sein. Getragen von Neugier, Respekt und Wohlwollen können so entscheidende Impulse gegeben werden.
Das kleine Einmaleins der Anti-Stigma-Arbeit
Folgende fünf Prinzipien bilden die Grundlage für eine strategische Veränderung von Stigma im Rahmen von Anti-Stigma-Kampagnen [mod. nach 3,5]
- Kontakt: Im Fokus sollte die direkte persönliche Interaktion von Menschen mit und ohne psychische Krankheit stehen.
- Gezielt: Der Kontakt sollte sich auf bestimmte Zielgruppen (z. B. SchülerInnen, PolizistInnen) konzentrieren – so ist er am wirksamsten.
- Lokal: Geografische und soziokulturelle Nähe und Bezüge sind vorteilhaft.
- Glaubwürdig: Anti-Stigma-Arbeit von Betroffenen/Angehörigen ist glaubwürdiger als von Profis. Dabei sollte Recovery demonstriert und damit der Fokus auf das Genesungspotenzial gelegt werden.
- Kontinuität: Langfristige Aktivitäten eignen sich besser als einmalige Aktionen.